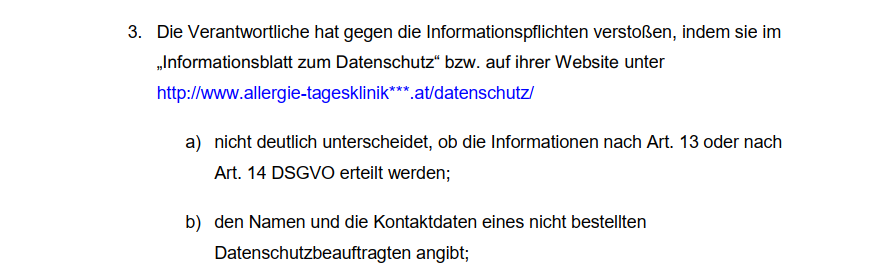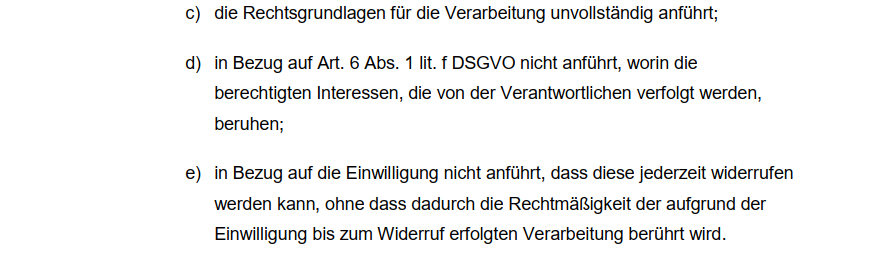Die bisherige deutsche Rechtslage führte zu „Cookie-Bannern“, bei denen Nutzer keine echte Wahlmöglichkeit hatten, sondern nur auf „Ok“ klicken konnten, um das nervige Banner aus dem Weg zu räumen.
1. Unbedingt erforderliche Cookies brauchen keine aktive Einwilligung
Zuerst das „Erfreuliche“: Wenn Cookies unbedingt erforderlich sind, sind Cookie-Banner, die nur weggeklickt werden können, rechtmäßig.
Unbedingt erforderlich können sein technisch notwendige und andere Cookies, die im Interesse des Nutzers sind, wie insb. Session-Cookies, die für einen Online-Warenkorb oder die Spracheinstellungen der Webseite verwendet werden bzw. die Seite ohne sie nicht betrieben werden kann. Es bleibt aber von den Datenschutzbehörden und Gerichten zu klären, wann Cookies unbedingt erforderlich sind und wann nicht.
2. Alle nicht unbedingt erforderlichen Cookies erfordern jetzt eine aktive Einwilligung
Andere Cookies werden aber genutzt, um pseudonymisierte Informationen über das Nutzerverhalten zu erlangen und personalisierte Werbeanzeigen zu platzieren, wie insb beim Tracking, zB Google Analytics.
Derartige Cookies sind rechtswidrig, wenn Cookie-Banner nur „weggeklickt“ werden können.
Solche Cookies für Werbe- bzw. Marketingzwecke benötigen jetzt eine aktive Einwilligung. Nutzer müssen die Möglichkeit haben, aktiv in nicht erforderliche Werbe- und Tracking Cookies im Sinne eines Opt-in einzuwilligen. Einwilligungskästchen müssen vom Nutzer aktiv angekreuzt werden; die bloße Bestätigung vorangekreuzter Felder genügt nicht.
Für die Anwendbarkeit der ePrivacy-Richtlinie ist es irrelevant, ob Cookies einen Personenbezug haben oder nicht. Darüber hinaus gilt bei Cookies, die einen Personenbezug haben, die DSGVO.
Zudem ließ der BGH für die Werbeeinwilligung eine Verlinkung auf eine Liste nicht genügen, denn diese Form der Gestaltung sei gerade zu darauf angelegt, den Nutzer dazu zu veranlassen, von einer Detailauswahl abzusehen und einfach alle Partnerunternehmen zu akzeptieren. In dieser Form jedoch sei dann die für die Einwilligung notwendige Informiertheit nicht gegeben.
4. Damit müssen sehr viele Seiten-Betreiber ihre Cookie-Banner ändern
Das Urteil wird große Auswirkungen auf die gesamte Werbewirtschaft im Internet haben, sowohl auf Webseiten-Betreiber als auch auf Anbieter von Tracking-Diensten. Kaum ein Nutzer wird freiwillig in das Sammeln von Daten zu seinem Surfverhalten zustimmen, wenn er die freie Wahl hat. Personalisierte Werbung im Netz zu platzieren, wird damit sehr viel schwieriger. Professionelle Rechtsberatung ist jedenfalls empfehlenswert.